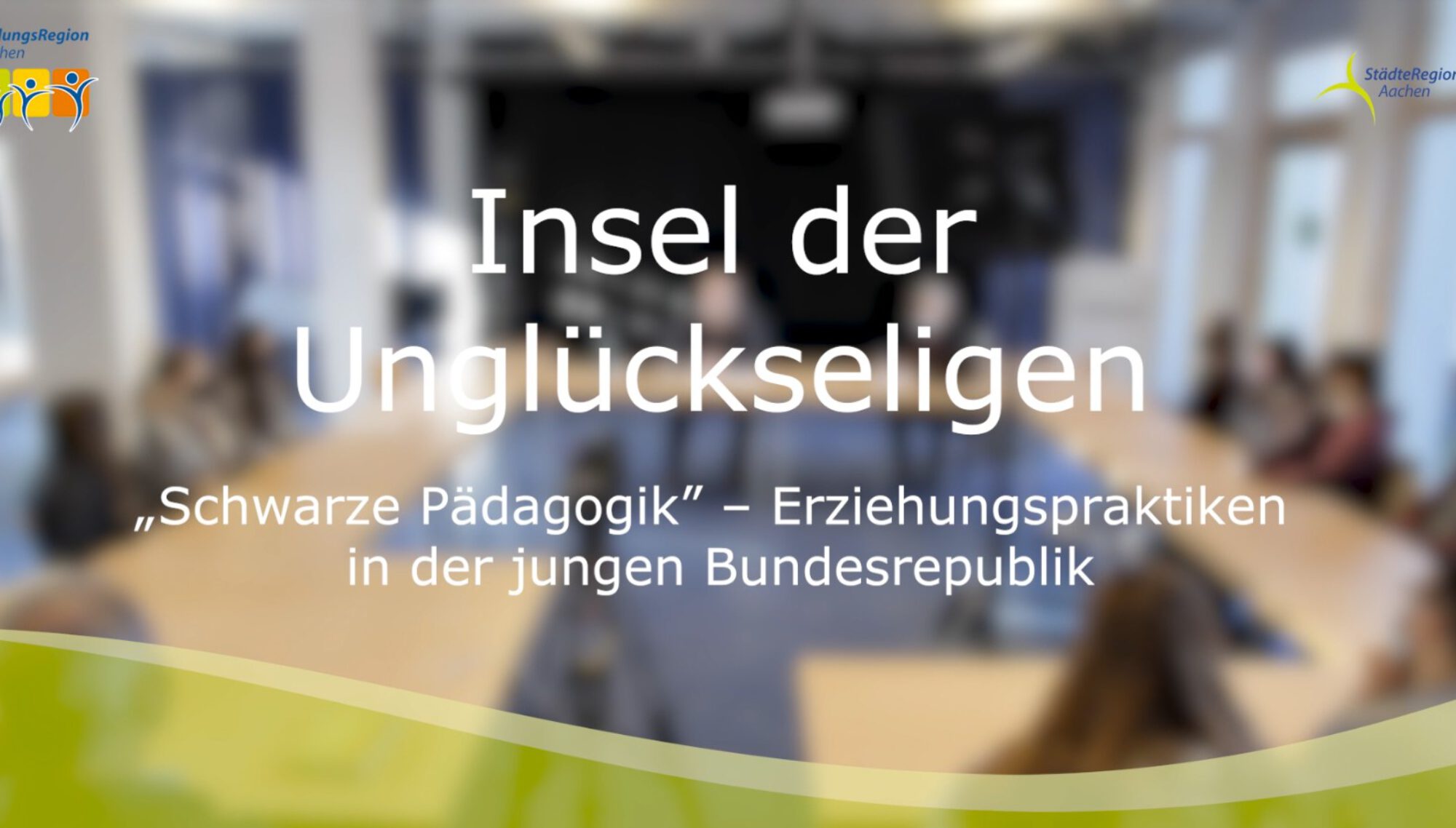„Dann stellt man sich mal vor, man sperrt mich … in ein Altenheim“
Forschungsprojekt: Psychosoziale Altersversorgung ehemaliger Heimkinder
Hintergrund
Zwischen den 1940er- und 1970er-Jahren in der damaligen Bundesrepublik Deutschland und bis 1989 in der DDR wurden in Heimen und sogenannten Fürsorgeeinrichtungen zahlreiche Kinder und Jugendliche in ihren grundlegenden Menschenrechten verletzt. Viele von ihnen erlebten Gewalt, Missbrauch und Demütigung. Die Folgen dieser Erfahrungen wirken bis heute fort – körperlich, psychisch und sozial.
Trotz dieser tiefgreifenden Traumatisierungen haben viele Betroffene über Jahrzehnte hinweg ohne nennenswerte Unterstützung von öffentlicher Seite überlebt. Sie verdienen nicht nur Anerkennung für ihr Leid, sondern auch für ihre beeindruckenden Bewältigungsleistungen. Dennoch zeigen sich gerade im Alter neue und komplexe Herausforderungen: Der Zugang zu Hilfs- und Pflegeangeboten ist für viele schwer, das Vertrauen in Institutionen oft erschüttert. Besonders die Angst vor Abhängigkeit oder erneuter Ohnmacht im Rahmen der pflegerischen Versorgung spielt dabei eine große Rolle.
Ziel des Projekts
Das Forschungsprojekt untersucht die Bedarfe ehemaliger Heimkinder mit sexualisierten Gewalterfahrungen im Hinblick auf eine angemessene psychosoziale Versorgung im Alter. Ziel ist es, zu verstehen,
- welche besonderen Unterstützungsbedürfnisse und Barrieren es gibt,
- wie Fachkräfte in der Altenhilfe und -pflege für diese sensiblen Themen sensibilisiert werden können, und
- welche Formen von Unterstützung und Begleitung geeignet sind, um Betroffene im Alter bestmöglich zu stärken.
Darüber hinaus werden auf Grundlage der Forschungsergebnisse Weiterbildungskonzepte für Fachkräfte der Pflege und Sozialen Arbeit entwickelt. Parallel dazu entsteht eine Informationsbroschüre, die sich an Betroffene wie auch an Fachkräfte richtet.
Zentrale Fragestellungen
- Welche spezifischen psychosozialen und pflegerischen Bedarfe haben ehemalige Heimkinder mit Gewalterfahrungen im Alter?
- Wie können Fachkräfte in der Altenhilfe und -pflege für diese Themen geschult und sensibilisiert werden?
Im Mittelpunkt steht dabei ausdrücklich die subjektive Sicht der Betroffenen: Ihre Erfahrungen, Sorgen und Erwartungen sollen sichtbar gemacht und in die Entwicklung künftiger Unterstützungsangebote eingebunden werden.

Wissenschaftlicher Ansatz
Das Projekt legt besonderen Wert auf ein traumasensibles Forschungsdesign. Viele ehemalige Heimkinder haben frühe Bindungsabbrüche und schwere Gewalterfahrungen erlebt. Diese biografischen Belastungen werden methodisch und in der Ergebnisinterpretation berücksichtigt. Die Forschung erfolgt unter Einhaltung strenger ethischer Standards und auf Basis eines offiziellen Ethikvotums.
Projektdaten
- Laufzeit: 01.08.2024 – 31.07.2026
- Finanzierung: Über Mittel der Kommission
- Projektleitung: Prof. Dr. Silke Birgitta Gahleitner
- Wissenschaftliche Mitarbeit: Marie Martensen, Senta Ebinger, Maite Gabriel
Bedeutung
Mit dem Projekt wird ein bisher wenig erforschtes, aber gesellschaftlich hochrelevantes Thema in den Fokus gerückt: die Lebenssituation und Versorgung ehemaliger Heimkinder im Alter. Es will nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen, sondern auch konkrete Handlungsempfehlungen und praktische Hilfen für Pflegeeinrichtungen, Beratungsstellen und Betroffene bereitstellen – damit Würde, Sicherheit und Teilhabe im Alter für alle Menschen gewährleistet werden.